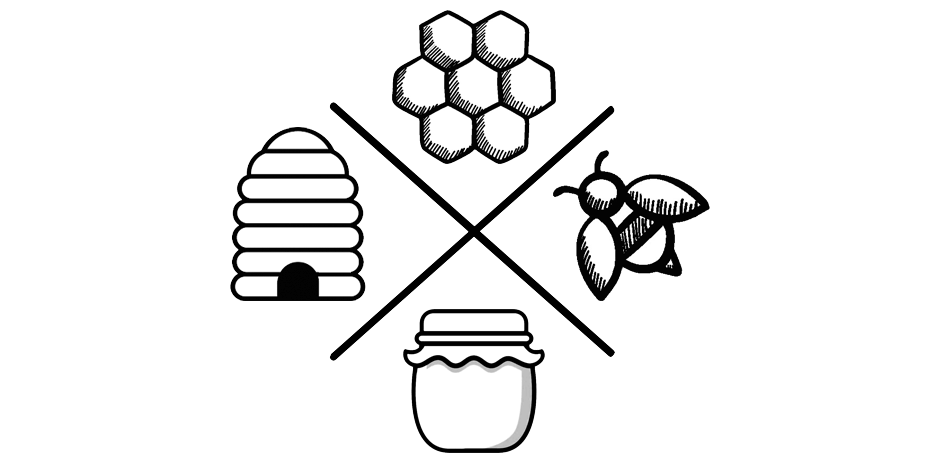
...von der Biene zum Honig

1
Das Bienenvolk
Das Bienenvolk beherbergt im Durchschnitt 35.000 Bienen, auch Volk genannt. Die Arbeiterinnen machen den größten Teil des Volkes aus. Sie legen täglich sehr große Distanzen zurück und fliegen dabei etliche Blüten an.
2
Die Honigblase
Dort nehmen sie den Nektar auf und speichern ihn in einer Art Kropf in der Nähe des Magens. In der Wissenschaft wird dieser Kropf Honigblase genannt. Hier wird der Nektar mit verschiedenen Enzymen angereichert und so in eine Mischung aus Frucht- und Traubenzucker verwandelt.
3
Der Grundstein
Dieser Prozess ist elementar für die Reifung des Honigs und der Grundstein für das von uns so sehr geliebte Endprodukt. Schwer beladen kehren die Arbeiterinnen in den Bienenstock zurück. Die so genannten Stockbienen stehen bereit um das Sammelgut in ihre Honigblase aufzunehmen.
4
Die Futterkette
Selbst Drohnen werden in diese Arbeit mit einbezogen, eine Futterkette entsteht. Angereichert mit Enzymen wird ein komplexer Fermentationsvorgang ausgelöst.
5
Der Fermentgehalt
Hierbei gilt zu beachten, dass der Fermentgehalt des Honigs deutlich steigt, wenn die Einlagerung in die Waben langsam erfolgt. Der nun beginnende Vorgang ist einmalig in der Natur.
6
Das Sammelgut
Die Stockbienen haben das Sammelgut aufgenommen. Es handelt sich noch um einen wasserreichen, zuckerhaltigen Rohstoff. Um diesen haltbar zu mach en muss er eingedickt werden.
7
Im Bienenstock
Hierzu pumpen die Bienen den Inhalt ihrer Honigblase heraus. Tropfenweise setzen sie ihn an der Unterseite ihres Rüssels der warmen Luft im Bienenstock aus. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis das Sammelgut die entsprechende Konsistenz aufweist.
8
Das Ablagern
Im Brutnestbereich beginnen die Bienen nun den halbreifen Honig an den Zellwänden abzulagern. Hier sind die Temperaturen optimal und der warme Luftstrom lässt das überschüssige Wasser verdunsten. Eine ausreichende Ventilation ist zwingend nötig, um den Wassergehalt deutlich unter 20% zu senken.
9
Reifungsprozess
Der weitere Reifeprozess des Honigs wird durch Bienensekrete und die dadurch entstehende Fermentierung angeregt. Im letzten Schritt wird der gereifte Honig von den Bienen in andere Zellen umgelagert. Die Jungbienen verfügen über Wachsdrüsen und verschließen mit diesem die vollständig gefüllten Zellen. Durch diesen Vorgang wird eine nachträgliche Wasseraufnahme verhindert. Für den Imker ist dieser „verdeckelte„ Honig das Zeichen für Reife und kann geschleudert werden.